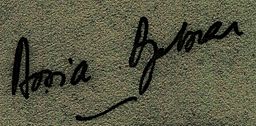Ein Herz und zwei Sprachen, die darin leben. Dem Herzschlag den ganz eigenen Rhythmus vorgeben, wovon die arabische „Muttersprache“ den emotionalen Part übernimmt.
Sie ist nach Aussage der algerisch-französischen Schriftstellerin Assia Djebar diejenige der Liebe, und die französische Sprache diejenige der Schrift. Ihre Texte verfasste die Autorin zeitlebens in der Sprache der „Unterdrücker“, die nötigen Emotionen für ihr Schreiben holte sie sich aus dem Arabischen.
Die Autorin verdeutlicht damit, was es heißt, in einem Land aufzuwachsen, das unter französischer Besatzung steht. Das heranwachsende Subjekt erfährt von Geburt an eine kulturelle Hybridität, die sich auf die eigene Sprache auswirkt. Eine Tatsache, die zu einer permanenten Unzugehörigkeit führen kann und gleichzeitig aber auch eine Chance birgt:
Zweisprachig die künstlich gesetzten Grenzen zwischen dem „Eigenen“ und dem „Fremden“ im eigenen Schreibprozess zu durchbrechen und in der kulturellen Unverortbarkeit sein neues Zuhause zu finden. Überall und nirgends zu sein.
So heißt der Titel des letzten, autobiographischen Textes der großen maghrebinisch-französischen Schriftstellerin Assia Djebar bezeichnenderweise auch „Nirgendwo im Haus meines Vaters„.
Nirgendwo im Haus ihres Vater wächst die kleine Fatima 1936 in der Nähe von Algier auf. Es ist das „Haus ihres Vaters“, nicht etwa das der Mutter, in dem die Tochter von einem strengen Hausherrn und einer modern-europäischen Mutter erzogen wird. Sie liebt ihren Vater, und trotzdem oder gerade aufgrund dieser tiefen Gefühle fressen sich erlebte Kränkungen in der frühen Kindheit in ihre Seele, die sich auf ihre Rolle als heranwachsende Frau in patriarchalen Strukturen bezieht. Mit vier oder fünf Jahren z.B., lernt Fatima im Hinterhof ihres Wohnhauses Fahrradfahren, aber als ihr Vater das sieht, verbietet er es mit folgenden Worten:
„Ich möchte nicht, dass meine Tochter aufs Fahrrad steigt und ihre Beine zeigt!“
Diese Worte richtet er vorwurfsvoll an seine Frau und ignoriert seine kleine, ihn verständnislos anblickende Tochter dabei. Assia Djebar erinnert sich Jahre später an dieses frühe Ereignis in ihrer Kindheit als einen unwirklichen Zustand, der sich mit der Furcht vor der Feindseligkeit paart, die der Vater ihr gegenüber zeigt. Sie kann nicht glauben, dass ihr geliebter Vater plötzlich zu einem Fremden wird:
„In den Augenblicken, die dann folgen, befinde ich mich in einem anhaltenden Nebel, alles scheint so unwirklich. Ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal gefragt: ‚Ist mein Vater noch derselbe? Oder ist er plötzlich ein anderer?'“
Zwei Worte bleiben dem kleinen Mädchen in Erinnerung: „Ihre Beine“. Was ist so falsch an ihren Beinen? Diesen wichtigen Bewegungsapparaten?
Schon früh erfährt Fatima, was es bedeutet, als Frau in einem muslimisch geprägten Land geboren zu sein. Das Gefühl von Freiheit, das sie als Heranwachsende spürt, als das metallene Gefährt unter ihrem Gesäß an Geschwindigkeit gewinnt, die Haare wild um den Kopf wehen und der Rock eben die Beine nicht mehr verdeckt – es ist genau das Gefühl, um das die Schriftstellerin Assia Djebar ihr Leben lang schreiben wird. Es in der Sprache der „Unterdrücker“ verteidigt, dem Französischen. Die aufgezwungene Sprache wird für sie paradoxerweise zum Befreiungsinstrument; ausreichend Wut für ihren Kampf schöpft sie wiederum aus dem Arabischen. Es ist ein Anschreiben gegen die Unsichtbarkeit, gegen das Gebot, sich als Frau unter einem langen Schleier verstecken zu müssen und nur in der Schule oder der weiblichen Geborgenheit des Hammam die Hüllen fallen lassen zu dürfen.
Mit fünfzehn Jahren im Internat bemerkt Fatima überhaupt zum ersten Mal bewusst, dass sie sichtbar ist. Es geschieht in dem Moment, in dem sie sich gegen die Verbote ihres Vaters auflehnt und heimlich eine Brieffreundschaft zu einem jungen Mann eingeht:
„Ich war also sichtbar, und ich wunderte mich darüber, denn nachdem ich stets von Frauen umgeben gewesen war, die verschleiert und maskiert waren, die sich unter Wolle, Seide, egal unter welchem Stoff verkrochen, fühlte ich mich in gewisser Weise ebenso un-sichtbar.“
Aber diese Sichtbarkeit schützt sie noch lange nicht davor, von Männern unterdrückt zu werden. In einem weiteren Erzählstrang spürt Djebar ihrer ersten Liebesbeziehung nach. Einer Beziehung, die sie zunächst nur eingeht, um ohne Schleier, weil mit einem „Begleiter“, durch die Straßen Algiers streifen zu können. Die fordernden, körperlichen Annäherungsversuche ihres männlichen Alibis lässt sie als notwendiges Übel über sich ergehen, weil sie die befreienden Spaziergänge zum Überleben braucht.
Wenn sie sich doch einmal alleine aufmacht, maskiert sie sich mit der Sprache der „Unterdrücker“, um von ihren Landsleuten nicht angespuckt zu werden. Denn absurderweise erzeugt die gleiche Muttersprache keine Solidarität unter den Geschlechtern, sondern Hassgefühle:
„Feindselig wären sie einem begegnet, die Angehörigen des eigenen Clans! Auf keinen Fall durfte man in ihrem Beisein den Schleier abnehmen oder seine Identität preisgeben. Doch eigentlich war man ja genau das: unverschleiert! Aber gleichzeitig auch ‚maskiert‘, ja, die fremde Sprache diente einem als Maske! Wohingegen die Muttersprache einen draußen verraten hätte, sie hätte einen denunziert. Fast hätte man mit dem Finger auf einen gezeigt!“
Das Auflehnen gegen patriarchale Unterdrückung nimmt mit fünfzehn Jahren selbstzerstörerische Züge an. Die Autorin bricht in ihrer autobiographischen Schrift dabei zum ersten Mal ihr Schweigen über diesen frühen Vorfall in der Jugend. Darin spielt ihr „Begleiter“ eine tragende Rolle, weil er versucht, seiner „Verlobten“ einen Befehl zu erteilen, den sie zu befolgen hat. Fatima ist über den Vertrauten enttäuscht und spürt in dieser einschneidenden Szene unmittelbar die Gefahr, die von der Macht des Gegenübers ausgeht. Kopflos flieht sie vor seinen zornigen Worten und hätte fast ihre eigene, andere Stimme, unter den Schienen einer Straßenbahn zum Verstummen gebracht.
Doch zum Glück reagiert der Fahrer geistesgegenwärtig und verhindert damit, dass eine der bedeutendsten weiblichen Stimmen des Maghreb noch bevor sie sich überhaupt entwickeln konnte, verklingt.
Für Djebar bedeutet eine Autobiographie zu schreiben, „sich selbst Lebewohl sagen“. Mit dem Satz wird offensichtlich, wie unentwirrbar semantisch verflochten das Schreiben und das eigene Leben für die Autorin ist. Auch die Autobiographie ist durchdrungen von fiktionalem – und dennoch wird bei dieser Form der Literatur die erzählende Person plötzlich schärfer erfasst. Der Erinnerungsprozess wird ein langer, mutig ausbuchstabierter Abschied von „sich“ und nicht zuletzt von den Lesern, die, alleingelassen inmitten eines begonnenen Freiheitskampfes, mit dem ernüchternden, letzten Satz der Autorin umgehen müssen:
„Warum, warum nur haben ich und all die anderen Frauen keinen Platz, ’nirgendwo im Hause meines Vaters‘?“
So ist das Resumé, das Djebar in ihrem Nachwort bezüglich ihres Freiheitskampfes zieht, ein vernichtendes. Was ihr bleibt, ist ein Gefühl der Niederlage, das sie, alleine mit ihren vielen Erinnerungen, einsam zurücklässt:
„Du schaust und zugleich erinnerst du dich, doch du befragst auch, im Inneren deines leeren Herzens, diese riesigen Schatten des Grolls, der aufrechten, hyperbolischen, stürmischen Niederlage. Und endlich bist du stumm! Endlich Stille. Nur du allein und deine offene Erinnerung. Und du reinigst dich mit Worten aus Staub und aus Glut. Dann gehst du, tätowiert, ohne zu wissen, wohin, dem Horizont entgegen, der genau vor dir liegt.“
„Nirgendwo im Haus meines Vaters“ ist Assia Djebars persönlichstes Buch, und nach Beendigung der Lektüre lässt es einen in einer Hoffnungslosigkeit zurück, die mit Blick auf die vielen Kriegsschauplätze der Welt ihre Berechtigung hat. Und dennoch möchte man der Autorin für ihre sonst mutmachende politisch-poetische Literatur gut zusprechen und das Versprechen geben, sich um ihr Erbe zu kümmern.
Denn vielleicht finden sich Freiheitskämpfer/innen, die sich, egal ob auf theoretische oder praktische Weise, Assia Djebars Gedankengut als Grundlage nehmen und darauf aufbauen.
Jetzt, wo sie selbst stumm dem „Horizont entgegen“ geht und sich nicht mehr äußern kann.