Herausragend besonders am autobiographischen Roman „Ma“ der Autorin Aya Cissoko ist der Effekt, der beim Lesen entsteht, wenn fast jede dritte Textzeile durch Sätze aus der malischen Sprache „Bambara“ unterbrochen wird. Die Zweisprachigkeit scheint zunächst störend, da der eigene Lesefluss durch unbekannte Worte ins Stocken gerät, man unmittelbar an der Übersetzung aus der fremden Sprache teilhat. Man meint, dieses Erzählverfahren mache die Geschichte kaputt, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es spiegelt intensiv die Zerissenheit einer Erzählerinnenstimme wider, die in zwei Kulturen ihren Platz finden muss. Die irritierende Form, die eine „Störung“ enthält, erzeugt dabei eine Nähe zur Protagonistin, die fremd und gleichzeitig vertraut ist.
„Das Fremde ist etwas, das sich zeigt, indem es sich entzieht“, betont der Phänomenologe Bernhard Waldenfels. Der Roman „Ma“ entzieht sich den LeserInnen auf formaler Ebene, bis eine Gewöhnung eintritt, und sie wenige Seiten später eintauchen können, in teilweise doch sehr fremde Welten einer Familie die aus Mali stammt, und in Paris lebt.
Massiré (Ma) Dansira, die Mutter aus Mali, ist die präsente Stimme im Bewusstsein der Tochter und Protagonistin Aya. Der Vater und die jüngere Schwester sterben früh bei einem Wohnungsbrand, und so ist es die Frau des Hauses, die fortan den Ton angibt. Für den afrikanischen Klan ist eine verwitwete Mutter, die ihre Kinder alleine versorgt, ein skandalöses Rätsel. Eine Frau braucht ihren Mann, so der Tenor des Patriarchats. Im Laufe der Handlung zeigt sich, dass es andersherum ist, dass sich immer wieder gescheiterte Männer an die Haustüre und in die Wohnung stehlen, die von Ayas hilfsbereiter Mutter durchgefüttert werden. Massiré ist stark, sie lehnt sich gegen jegliche Form männlicher Bevormundung auf. Gleichzeitig hat sie Prinzipien, mit denen sie ihre Kinder oft an den Rand der Verzweiflung bringt. Wäsche wird z. B. mit der Hand gewaschen. Auch, oder gerade in Paris. Helfen müssen dabei alle Familienmitglieder, denn:
„Ala k’an kisi fugariden wolo ma. Gott bewahre mich vor einer schlechten Brut. Kinder sind dazu auf der Welt, ihren Eltern zu helfen.“
Diesem Anspruch verleiht sie durch exzessive Fluchtiraden Nachdruck: „Ich werf dir meine beiden Füße in den Hintern. Schwachsinnige, reiß den Arsch auf… .“
Hinter den oft lieblos wirkenden Umgangsformen steckt jedoch ein Plan, der nur aufgeht, wenn er mit aller Härte und Willenskraft verfolgt wird. Gerade als schwarze Frau hat man es nicht leicht, in Europa die Bildung zu erfahren die nötig ist, um nicht als Putzfrau weißen Geschäftsmännern die Schreibtische säubern zu müssen. Dessen ist sich Ma bewusst, weil sie als Analphabetin genau diese Knochenarbeit Tag für Tag erledigt. Vom afrikanischen Klan in Mali ist keine Hilfe zu erwarten, und die möchte sie auch nicht. Der meint sowieso, dass sie sich sicher prostituiere, um über die Runden zu kommen.
Doch die Männer täuschen sich. Ma wird zum Vorbild für andere afrikanische Frauen in Paris, was der Klan erwartungsgemäß negativ kommentiert: „Faransi musow jamanen. In Frankreich werden die Frauen frech!“.
Frech ist auch die Tochter, die sich an der dominanten und oft auch ignoranten Mutter reibt, sich aber weder durch Schläge noch Beschimpfungen bändigen lässt. Zum normalen Abnabelungsprozess einer Mutter-Tochter-Beziehung mit dem natürlichen Auseinandersetzungspotential bringen die zwei Kulturen zusätzlichen Zündstoff. Wie soll eine (pubertierende) Tochter aber auch damit umgehen, wenn die Mutter es ihrem neuen Ehemann erlaubt, die eigene Wohnung in eine Praxis für Wahrsagerei zu verwandeln, in der die seltsamsten Patienten ein- und ausgehen?
Nicht nur im Kapitel „Der Wahrsager“ kollidieren unterschiedliche Lebenseinstellungen miteinander. Auf der einen Seite steht die Hilfsbereitschaft einer Mutter, die ihre afrikanische Abstammung immer wieder betont, auf der anderen ein Mädchen, das sich nach Privatspäre sehnt, um sich (ohne Eheversprechen!) mit der ersten Liebe zurückziehen zu können.
Trotz aller Konflikte und menschlicher Katastrophen, die in diesem Buch beschrieben werden, zeigt sich, dass es eine Bereicherung ist, zweisprachig zu leben, zwei Kulturen in sich zu tragen. Wenn man es schafft, alle Stimmen miteinander, und nicht gegeneinander sprechen zu lassen, beide kulturellen Einflüsse als gegebene zu akzeptieren. Sollte das auch bedeuten, harte Kämpfe mit sich und den anderen auszufechten.
Aber egal ob die MitbürgerInnen in Paris aus Afrika oder Europa stammen, an Geister glauben, oder an die neusten Modetrends. Der Impuls das andere, ungewohnte, kritisch zu beäugen, um es dann abzuwehren, ist allgegenwärtig und entsteht aus der menschengemachten Illusion, zu einer einzigen Kultur fest dazugehören zu müssen.
Texte wie diejenigen von Aya Cissoko machen kulturelle Grenzen luzide und bestätigen nicht zuletzt, wieviele Gemeinsamkeiten Kulturen, bei allen Differenzen miteinander haben. Der Sauberkeitsfimmel von Ma etwa erinnert stark an den Reinlichkeitswahn einer schwäbischen Kleinfamilie:
„Ich mag keinen Schmutz!“, zitiert die Protagonistin ihre Mutter wiederholt. Denn wer die Wohnung und seine Kinder nicht sauber hält, lädt Schande auf sich. Der Sohn erfährt dabei keine Ausnahme. Er hat den Boden zu schrubben, wenn er nicht des Heims verwiesen werden möchte. An dieser Haltung könnten sich manche pseudoemanzipatorische Eltern mit biodeutscher Herkunft, was immer das auch bedeutet, ein Beispiel nehmen.
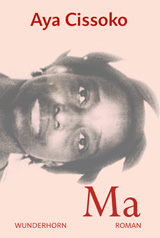
Neue Kommentare