In ihrem 2015 bei der Edition Nautilus erschienen Skandalroman „Erschlagt die Armen!“, erhalten die LeserInnen Einblick in ein abgeschlossenes System; das der Migrationsbehörde Paris. Dort wird hinter verschlossenen Türen darüber entschieden, wer einen Asylstatus erhält, und wer nicht. Die Protagonistin, eine Dolmetscherin, ist diejenige von der erwartet wird, dass sie die Leidensgeschichten der Flüchtlinge verständlich für den sogenannten „Entscheider“ übersetzt. Zusätzlich zur Übersetzungsarbeit soll sie diesen „fremden Männern“, die alle Hilfe von ihr fordern, Empathie und Verständnis entgegenbringen.
Zunächst irritiert der fast menschenverachtende Ton, die unbarmherzige Weise, auf die die Erzählerin von den „ungeliebten Quallen“ berichtet, die „sich an fremde Ufer geworfen haben“. Zumal diese Sätze von einer Person stammen, die selber vor einigen Jahren in Frankreich „gestrandet“ ist, und sich eigentlich solidarisch verhalten müsste. Doch sie hat die immergleichen Erzählungen der Hilfesuchenden, fast ausschließlich männlichen „Quallen“, satt, weil sie ihr Lügengeschichten unterbreiten, die sich inhaltlich kaum voneinander unterscheiden. Ihr werden auswendiggelernte, fiktionale Lebensgeschichten erzählt, weil das „System Behörde“ nur denjenigen eine Chance auf Bleiberecht gewährt, die ihre Erfahrungen wie Schauspieler an ein Publikum verkaufen können.
Drei unterschiedliche „Sprachen“ treffen jeden Tag in den unwirtlichen Büroräumen aufeinander, und Aufgabe der Dolmetscherin ist es, von einer Sprache zur anderen zu springen, und sich von ihr „benutzen“ zu lassen, das Werkzeug dafür zu sein, dass die Unwahrheiten gehört werden können:
„Der Entscheider sprach seine Sprache, die Sprache der verglasten Büros. Der Antragsteller sprach seine flehende Sprache, die Illegalen-Sprache, die Ghetto-Sprache. Und ich nahm seine Sätze, übersetzte und servierte sie heiß. Die Fremdsprache schmolz in meinem Mund, hinterließ ihr Aroma. Die Wörter meiner Muttersprache lagen mir beim Sprechen sperrig im Mund, lähmten meine Zunge, hallten in meinem Kopf nach, hämmerten in meinem Hirn wie falsche Töne eines verstimmten Klaviers. Sie waren eine klägliche, schwankende Hängebrücke zwischen den Antragstellern und mir.“
Das Verhältnis der Protagonistin zu ihrer Muttersprache ist kein gutes. Die Sprache ihrer Geburt fühlt sich falsch an, und hindert sie fast daran, überhaupt Worte von sich geben zu können. Die Fremdsprache wiederum, also das Französische, entwickelt sich interessanterweise zu einem individuellen Geschmack, den sie nicht wieder verlieren möchte. Es ist der Geschmack, der sie nach Paris gelockt hat, und mit dem sie auch von ihren Mitmenschen in Verbindung gebracht werden möchte.
Durch ihre ambivalente Zwischenposition in der Behörde spitzt sich die Sprachenkrise zu und wird zu einer Identitätskrise. Eines Tages schlägt die Ich-Erzählerin einem Migranten in der U-Bahn eine Weinflasche über den Kopf, weil er sie verbal provoziert hat. Plötzlich ist sie selber das rätselhafte Tier in der Zirkusmanege, muss Auskunft über etwas geben, das sich mit Worten nicht wirklich beschreiben lässt. Protokollhaft versucht ein Ermittler im Gespräch mit der Protagonistin zu rekonstruieren, wie es zu dem Gewaltausbruch kommen konnte. Wie Mosaikteile reihen sich mögliche Gründe für den Gewaltausbruch im Verlauf der Geschichte aneinander. Und es ist nicht nur die Sprachenzerrissenheit, das Wandeln zwischen den Sprachkulturen, die sie zu der drastischen Maßnahme greifen lässt. Es ist gerade auch er unterschwellige Hass der geflüchteten Männer, dem die Dolmetscherin als Frau verstärkt ausgesetzt ist, der ihr Inneres mit der Zeit in eine wütende Chaoslandschaft verwandelt:
„Und dann erdreistete sich diese Frau, sie, die Männer, auszufragen. In der guten alten Zeit, vor diesen unvorhergesehenen Ereignissen auf den Meeren und in den Büros, als Männer noch Reis anbauten und Gewürze verkauften, ohne bei der Heimkehr tausend Papiere vorzeigen zu müssen, hätten sie einer Frau, die mit erhobenem Kopf und lauter Stimme mit ihnen redete, die in ihren Geheimnissen herumschnüffelte und sie angeblich falscher, widersprüchlicher Aussagen überführte, eine Ohrfeige verpasst.“
Die Erzählerin fühlt sich verfolgt von den Worten, die aus den Mündern der Bittsteller strömen, wird nachts von ihnen eingeholt. So stürzt die Sprachgymnastin vom Trapez, weil ihr das Gleichgewicht nach und nach abhanden kommt. Das Gleichgewicht, das überlebensnotwenig ist, um zwischen den Sprachwelten zu balancieren.
Subtil aber gut erkennbar schwelt im Roman Kritik am „System Europa“, in denen die Flüchtlinge als „Sklaven des neuen Jahrtausends“ mißbraucht werden, das Resultat einer Politik, mit dem die Festung Europa, ein „Europa auf Morphium“, ihre Inhumanität immer wieder aufs neue bestätigt. Denn Schuld an den unhaltbaren Zuständen auf der Behörde sind nicht die Flüchtlinge. Allerdings zeigt die Autorin an keiner Stelle des Romans mit moralisierendem Zeigefinger auf all die menschlichen Tragödien und Ungerechtigkeiten. Vielmehr eröffnet sich ein wütender Textteppich, auf dem sich Lüge und Wahrheit ein Gefecht liefern, das gerade auch durch die eindrückliche Sprache, die ungewöhnlichen Metaphern, eine literarische Kraft besitzt, die verstört.
Auch wenn die Protagonistin an ihrer bilingualen Sprachenexistenz zu verzweifeln droht, weil sie die Muttersprache gerne abstreifen würde wie ein lästig gewordenes Kleidungsstück – auf poetologischer Ebene entstehen neue, ungewohnte Bilder, die durch eine permanente gedankliche Übersetzungsarbeit im Kopf gebildet werden, und eine besondere, originelle Qualität haben.
Die algerisch-französische Autorin und Trägerin des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, Assia Djebar, hat zu ihrem Verhältnis, zu ihrer Zwei-Sprachen-Existenz, die ihr Leben formte, einmal gesagt, dass das Arabische, also die Muttersprache, den emotionalen Part in ihrem Leben übernommen habe. Die Sprache der Unterdrücker, das Französische, sei ihre Schriftsprache gewesen.
Vielleicht ging es Shumona Sinha beim Schreiben ähnlich. Möglicherweise hat ihr die Muttersprache die nötige wütende Phantasie für diesen Text gegeben, in denen Richter und ihre Beisitzer bei der Anhörung eines Migranten als „so sensibel wie Nashörner“ beschrieben werden können. Das Französische wird dabei zum Schreibwerkzeug, zu der Sprache, die die Worte aufs Papier bringen und sie nicht weiter unruhig im Körper umherschwirren lassen.
Das Verhörprotokoll endet mit dem nur scheinbar versöhnlich klingenden Satz:
„Es ist Zeit, nach Hause zu gehen“.
Bleibt die Frage, wo das für eine Weltenwandlerin, wie die Erzählerin eine ist, genau sein soll. Im Dazwischen der Sprachen, im permanenten Transit oder eben gerade in der Unverortbarkeit der eigenen (sprachlichen) Existenz?

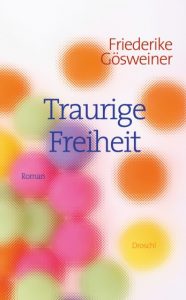





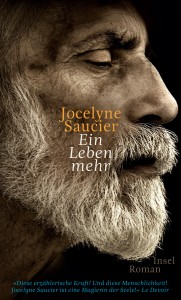



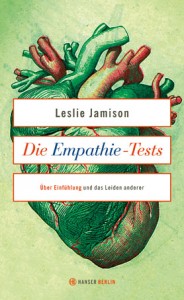


Neue Kommentare