„Sich erinnern. Und auch wer wir selbst sind. Sich erinnern und heimfinden.
Wie die Zeit vergeht.“
(Kurzeck, Peter. Als Gast. Frankfurt, 2012)
Im Erinnerungsfluss sich sein Leben erzählen. Der Frankfurter Autor Peter Kurzeck hat es ein Lebtag lang versucht. Immer wieder nach den richtigen Worten gesucht, um sich sich selbst in dieser Welt überhaupt vorstellen zu können. Im Hier und Jetzt. An der Bockenheimer Landstraße entlang ins ausgestorbene Westend hinein. Ein einsamer Fußgänger mit Vergangenheit, vergangener Zeit, an die er nicht aufhören kann, sich zu erinnern. Ein Wettlauf gegen die Zeit mit der Zeit; wohin werden ihn seine müden Beine tragen?
Peter Kurzecks mehrteilig-unvollendetes und im Frankfurter Stroemfeld Verlag erschienenes Romanprojekt „Das Alte Jahrhundert“ erfordert Konzentration und die Bereitschaft sich voll und ganz einzulassen auf einen Protagonisten, der sich ohne gesunden Selbstschutz seiner Mitwelt aussetzt. Der wie ein Schwamm sämtliche, auf ihn einstürzenden Erfahrungen in sich aufnimmt, um dann damit zurecht zu kommen. Es gibt für ihn keinen Alkohol (mehr) und auch keine sonstigen Drogen, um die Wirklichkeit erträglicher zu empfinden.
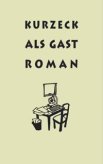
Kurzeck. Als Gast.
Quelle: Stroemfeld Verlag Frankfurt a. M.
Wenn man sich hinein begibt in diesen dichten Erzählstrom, dann eröffnen sich Wahrnehmungswelten, die eine vergangene Zeit lebendig werden lassen. Im Roman „Als Gast“ z.B. die beginnenden 80-er Jahre in Frankfurt Bockenheim:
„Eine Frau. Nicht mehr jung. Leere Einkaufstaschen. Im Kopf eine lange Liste mit Sorgen und alles, was sie nicht vergessen darf. Vielleicht lacht sie gern, aber hat schon lang nicht gelacht und weiß nicht mehr, dass sie gern lacht. Weiß nicht mehr, wie es geht. Vielleicht eine Griechin, die am Rand von Bockenheim oder in Ginnheim, in Hausen, in Rödelheim wohnt und hat eine Arbeit bei Hartmann und Braun oder im HL, beim Plus, beim Penny, beim Aldi, beim Schlecker zur Aushilfe und dazu noch vier Putzstellen. Alle Tage eine große Familie oder schon lang mit sich selbst allein.“ (Als Gast S. 412)
Voller Empathie betrachtet der Protagonist eine unbekannte Frau, dichtet ihr ein Leben an, das genau so sein könnte. In der Phantasie des Beobachters ist auch sie mit ihren Sorgen ganz alleine, kämpft jeden Tag neu ums Überleben. Beim Lesen von Kurzecks Romanen werde ich manchmal an den Frankfurter Autor Wilhelm Genazino erinnert, weil auch er Seite um Seite mit Beschreibungen alltäglicher Szenen auf der Straße füllen kann. Worin sich beide allerdings unterscheiden, ist die emotionale Ebene. Den Figuren Genazinos fehlt die empathische Anteilnahme in der Beobachtung; sie empfinden bestenfalls Mitleid für ihr Gegenüber. Personen oder Geschehnisse werden dabei vom Ich-Erzähler mit einer entlarvenden Schonungslosigkeit beschrieben, zu der Kurzecks Figuren niemals fähig wären.
Vielleicht halte ich Kurzeck deswegen für einen politischen Autor. Weil er es durch seine sensiblen Alltagsbeschreibungen erreicht, ohne forciert-moralisierenden Grundtenor auf soziale Missstände hinzuweisen. Beobachtete, fremde Objekte werden in den Selbstgesprächen des Ich-Erzählers zu Subjekten mit einer eigenen (leidvollen) Geschichte, die er erzählen muss, weil er sich ein stückweit auch immer mit ihnen identifiziert. Sein eigenes Leben in den beschriebenen, (fiktiven) Geschichten der Anderen wiederfindet. Aus diesem Grund braucht er manchmal auch einen ganzen Tag für ein paar Sätze. Die Arbeit eines Schriftstellers lässt sich nicht alleine am schriftlich fixierten output messen; die oft zermürbende Sammelei von Eindrücken gehört genauso dazu. Aber erzähle das einmal dem Arbeitsamt:
„Und wenn Sie nicht schreiben? fragt Anne. Die Pausen? Trotzdem, sagte ich, auch wenn man nur anderthalb Sätze am Tag, man braucht immer den ganzen Tag dafür!“ (Als Gast. S. 408)
Die innerliche, einsame, von Selbstzweifeln erschütterte Schreibarbeit hört niemals auf. Zeitmangel ist deswegen immer vorhanden, weil die Ruhepausen fehlen, in denen die Zeit gefühlt langsam verstreichen könnte:
„Im Verzug, sagte ich. Mit der Arbeit und mit meinem Leben. Seit Jahren schon und mit jedem Jahr mehr! Sagt man in oder im Verzug? Vergangen die Zeit!“ (Als Gast, S. 395)
Seiner Schreibarbeit bleibt er auf die Art immer etwas schuldig, hinkt den zu vollendenden Sätzen hinterher. Er klingt wie ein genervter Chef, der seinen Angestellten darauf hinweist, dass er die Arbeit zu langsam erledigt hat und deswegen ein elender Versager ist. Arbeit und Leben gehen eine unentwirrbare Sinnsymbiose ein, die für heutige, vom Kapitalismus geprägte Lebensentwürfe oft selbstverständlich scheint. Peter Kurzeck übernimmt dabei typisch formalisierte Begriffe aus der Arbeitswelt, um damit sein Außenseiterleben als Schriftsteller infrage zu stellen. Der Protagonist weiß, wie es zugeht in der Welt des Broterwerbs und hat sich eines Tages für den unsicheren Weg entschieden, weil es nicht anders ging. Die Worte in seinem Kopf, auf dem Gehsteig oder im Eiskaffee aufgesammelt, in eine Form gebracht werden mussten. Der Frau auf dem Sozialamt, wie sollte er ihr nur erklären, was er da tat. Etwas ohne sichtbares Resultat für diejenigen, die nicht richtig hinsehen wollten. Diejenigen, die nicht wie er dem Bann der Sprache verfallen waren, keine Sprachpoesiejunkees weit und breit in den Büros, die fühlten, was er empfand. Und trotzdem. Immer wieder. Auch wenn er oft nicht mehr wollte, sich nach einer „ordentlichen“ Arbeit sehnte, nach einer anerkannten Existenzberechtigung. Solange sich ihm die Worte immer wieder auf seinen Streifzügen durch die Stadt aufdrängten, sich ohne kurze Bewusstseinstrübung ihren Erzähler holten, blieb ein kleiner Trost. Er konnte so tun, als ob wenigstens die Zeit in solchen Momenten ganz ihm gehörte:
„Und jetzt auf dem Heimweg im Gehen im Kopf schon zu schreiben anfangen. Als ob mir das zusteht. Arbeitslos, Schriftsteller. Daß es eine Zeit gibt. Daß die Zeit mir gehört. Und auf jedem Weg dir weiter dein Leben ausdenken.“ (Kurzeck. Ein Kirschkern im März. S. 220 Band 3)
Peter Kurzeck wurde als kleiner Junge 1946 mit seiner Familie aus dem Sudetenland vertrieben und verbrachte seine Kindheit mit seiner Mutter und Schwester in Staufenberg bei Gießen. Das Vorwort aus dem dritten Band „Ein Kirschkern im März“ lautet dann bezeichnenderweise auch: „Von weither und fremd, überall fremd. Aus Böhmen und ohne Haus.“ Fremdheit ist der durchgängige Hintergrundblues in den Bänden „Das Alte Jahrhundert“. Auch bei guten Freunden fühlt sich der Protagonist nur als „Gast“. Ein Traumwandler, der sich seines Zustandes von Jahr zu Jahr bewusster wird, ihn aber auch bei anderen wahrnimmt:
„Und jeder in seinem eigenen Traum, zeitlebens in seinem eigenen Traum gefangen.“ (Peter Kurzeck. Übers Eis. Seite 142. Band 1)
Wie können der fortschreitende Wirklichkeitsverlust gestoppt und mögliche Alpträume verhindert werden? Eigentlich durch neu gemachte Erfahrungen, dadurch, dass der Protagonist nach vorne schaut und schmerzreiche Erinnerungen schriftlich verarbeitet werden. Genau das geht nur mithilfe der Worte, dem permanenten Versuch, unbeschreibbares auszubuchstabieren. Aus dem Inneren herauszuschreiben und sich der Öffentlichkeit zu erklären. Um sich dann Schritt für Schritt seiner eigenen Existenz in dieser Welt gewiss zu werden.
Trotz der oft sehr schwermütigen Stimmung in Kurzecks Poetologie bleibt zuletzt immer die Hoffnung auf eine bessere Zeit. Hoffnungsboten sind die Kirschkerne im März, die unter der Schnee- und Frostdecke überwintert haben. Sie erzählen vom Frühling, der die müde Kälte vertreibt und die Lebensgeister weckt. Den Frühling 2014 konnte Peter Kurzeck nicht noch einmal erleben, weil der neblige November stärker war. Der Monat im Jahr, in dem die guten Geister sterben. Vielleicht findet dieser Blog im Gedenken an diesen besonderen und leider viel zu unbekannten Schriftsteller Leser/innen, die trotz Hektik und Stress im Alltag weiterhin auf die Kirschkerne und deren glückversprechende Nachricht achten. Damit wir, mit Kurzeck gesprochen, nicht selbst „zu Gespenstern werden“, sondern hellwach unseren individuellen Geistern ihren Überlebenswillen zurückgeben.
I hope so.
„Noch einmal die Seestraße entlang. Müd, immer müder. Die Zeit ruckt. Und jetzt kommt die Dämmerung. Grün die Luft, Abend. Und in allen Höfen, in jedem Baum, unter jedem Küchenfenster singt eine Amsel. Vorfrühling, ein langer schmerzhafter Vorfrühling.“ (Kurzeck. Kirschkern. S. 232)


