
Die Schriftstellerin und Philosophin Christine de Pizan (1364 in Venedig geboren), sitzt um 1405 in meditativer Einsamkeit in ihrem Studierzimmer, „umgeben von vielen Büchern aus verschiedenen Sachgebieten“. Als ihr die hasserfüllte Schmähschrift über Frauen des damals anerkannten Autors Mateolus in die Hände fällt, gerät sie ins Grübeln über ihr eigenes Geschlecht. Wie konnte es sein, dass berühmte Philosophen, Dichter und Gelehrte, sich alle gleich schlecht über Frauen ausließen, sie als „lasterhaft“ bezeichneten, wo Christines Eindruck und der von ihr dazu befragten Frauen, ein ganz anderer war? Die Philosophin geht zunächst empirisch vor, diskutiert mit Fürstinnen und Frauen unterschiedlichster sozialer Schichten über die Aussagen der Gelehrten. Obwohl sie diesen widersprechen, kann sie es trotzdem nicht glauben, dass so kluge Männer unrecht haben könnten. Sie verzweifelt regelrecht am Widerspruch zwischen ihrem eigenen, positiven Urteil, das die moralische Integrität zahlreicher Frauen bestätigt und der vernichtenden Meinung der männlichen, akademischen Elite. Verzagt führt sie ein Zwiegespräch mit Gott, argumentiert folgendermaßen:
„Ach, Gott, wie ist das überhaupt möglich? Denn wenn mich mein Glaube nicht trügt, dann darf ich doch annehmen, dass Du in Deiner grenzenlosen Weisheit und vollkommenen Güte nichts Unvollkommenes erschaffen hast. Aber hast du nicht selbst, und zwar auf eine ganz besondere Weise, die Frau erschaffen und sie dann mit all jenen Eigenschaften versehen, die Du ihr zu geben beliebtest? Es ist doch undenkbar, dass du auf irgendeinem Gebiet versagen solltest!“
Christine hadert zum Glück nicht lange allein mit sich und diesem Widerspruch. Sie bekommt Unterstützung von drei allegorisch zu verstehenden edlen Frauenfiguren, die ihre Tränen trocknen. Die drei Lichtgestalten bestätigen ihr, dass selbst die größten Philosophen manchmal „Ammenmärchen“ erzählen und sie deren Thesen bitte nicht alle als „Glaubensgrundsätze“ auslegen solle. Sie begründen ihre Meinung damit, dass selbst der heilige Kirchenvater Augustinus den großen Aristoteles korrigiert habe, es also üblich sei, das Denken anderer Kollegen infrage zu stellen. Frau Vernunft, Frau Rechtschaffenheit und Frau Gerechtigkeit ermutigen Christine empowernd, ihren eigenen Verstand zu bedienen und nicht einfältig jede Lüge zu glauben.
Nach diesem starken Intro fordert Frau Vernunft Christine auf, die Stadt der Frauen mit der Unterstützung der drei Erleuchteten zu erbauen. Den Mörtel steuert sie selbst bei, in Form von Erzählungen über tugendhafte Frauen. Darunter sind herausragende Kriegerinnen, Dichterinnen und Denkerinnen, die aus der griechischen Antike stammen. Da wird die kühne Amazonenkönigin Penthesileia genannt oder auch die Dichterin Sappho. Auch aus berühmten Erfinderinnen, wie beispielsweise Minerva, die das Eisen erfand, soll die Grundfestung der Stadt entstehen. Christine nimmt im Gespräch mit der jeweiligen Frau die Rolle der fragenden Philosophin ein, die Einwände erhebt, während die weisen Frauen geduldig antworten. Das erinnert stark an sokratische Gespräche, wo Christine sich skeptisch als die alles hinterfragende Schülerin inszeniert.
Frau Rechtschaffenheit betont in der zweiten, der dreiteiligen Abhandlung, dass nur kluge und rechtschaffene Frauen die Stadt bewohnen dürfen. Christine begibt sich mit ihr auf die Suche nach ihnen, erfährt prüfend von deren Taten. Frau Rechtschaffenheit beschreibt zum Beispiel das tugendhafte Leben der Prophetinnen, egal ob jüdisch, christlich oder „heidnisch“. Sie kommen alle in den erbauten Schutzraum hinein. So auch die Königin von Saba oder die Seherin Kassandra, Tochter des trojanischen Königs Priamos.
Die These vieler Männer, dass Frauen in der Ehe nicht zu ertragen seien, wird durch Gegenbeispiele ad absurdum geführt, indem zahlreiche Geschichten über sich sorgende, treue und aufopferungsbereite Gattinnen erzählt wird. Es täte den Herren allerdings gut, wenn sie sich den Ratschlägen ihrer Frauen nicht zu oft widersetzten. Ihr Leben würde sich verlängern, auch dafür gibt es Beispiele. Christine wendet hier nachdenklich ein, dass ein Gelehrter folgendes gesagt habe:
„Hohe Frau, ich erinnere mich jedoch auch daran, dass der Philosoph Theophrast, von dem ich weiter oben gesprochen habe, behauptet, die Frauen hassten ihre Ehemänner, wenn diese vorgerückten Alters seien; außerdem liebten sie weder Wissenschaftler noch Gelehrte. Er verbreitet nämlich, das Studium der Bücher sei unvereinbar mit der Aufmerksamkeit, die man den Frauen im ehelichen Zusammenleben widmen müsse.“
Als Gegenbeispiel nennt Frau Rechtschaffenheit unter anderen die Tochter des Herrschers von Julius Cäsar, die ihren gebrechlichen Althelden Pompeius so treu liebte, dass sie vor Schock stirbt, als sie fälschlicherweise denkt, ihr Mann sei bei einer Tieropferung ums Leben gekommen.
Warum Pizans philosophische Utopie von der Stadt der Frauen auch heute noch eine erschreckende Aktualität besitzt, zeigt sich an dieser Frage, die sie an Frau Rechtschaffenheit stellt, besonders:
„Hohe Frau, ich glaube euch aufs Wort und bin überzeugt, dass es genügend schöne, gute und sittsame Frauen gibt, die sich sehr wohl vor den üblen Machenschaften der Verführer zu hüten wissen. Um so mehr betrübt und bekümmert es mich jedoch, die Männer so häufig behaupten zu hören, Frauen wollten vergewaltigt werden; aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Frauen an einer solchen Gemeinheit Gefallen finden sollen.“
Gerade wurde in einer aktuellen Studie bestätigt, dass jeder dritte Mann in Deutschland Gewalt gegen Frauen in Beziehungen akzeptabel findet. Hier wird zusätzlich absurderweise darüber diskutiert, ob Frauen Spaß an dieser Gewalt haben, der an ihrem eigenen Körper verübt wird. Fast ärgert man sich beim Lesen über die naiv klingende Frage von Christine und man möchte ihr sagen, dass sie doch bitte die „Spitzhacke ihres Verstandes“ noch etwas schärfen sollte, damit sie in Zukunft stärker an ihn glaubt.
Schutzräume werden mehr denn je gebraucht, doch Christine hatte nicht etwa Frauenhäuser im Blick, in denen die hilfebedürftigen Frauen temporär leben können, sondern es ging ihr um einen stabilen Aufenthaltsort, in dem sich die geballte Frauenpower sammeln und organisieren konnte. Denn Frauen besitzen sowohl Intellekt als auch körperliche Kräfte, die sich voll entfalten können, wenn sie alle solidarisch zusammenhalten und an ihre Macht glauben. Gleichzeitig muss im Blick behalten werden, dass die Philosophin sich diese Stadt als einen idealen Raum, ohne konkreten Wirklichkeitsanspruch, erdacht hat.
Mithilfe der letzten Allegorie, Frau Gerechtigkeit, wird die Himmelskönigin Maria in die Stadt eingeführt, damit sie sie weise regiere. Ohne göttlichen Segen funktioniert im Spätmittelalter kein gerechtes Miteinander, die Reden der drei weisen Frauen gegen hate speech haben nur dann Bestand, wenn sie durch eine metaphysische Kraft als gut legitimiert werden. So kann die „Stadt der Frauen“ als „Zufluchts- und Trostraum“ für eine „feminine Elite“ bezeichnet werden, wie die Herausgeberin und Übersetzerin Margarethe Zimmermann betont. Gleichzeitig ist sie aber auch ein Möglichkeitsraum und offen für jede tugendhafte Frau, die eine Bewohnerin werden möchte.
Pizans Werk ist ein tiefgründiger, frühfeministischer Klassiker der Weltliteratur, der die Leser:innen dabei mit viel Witz und differenzierter Klugheit in spätmittelalterliche Diskurse entführt, die durch männliches Denken durchdrungen sind. Die kritischen Fragen der Philosophin durchbrechen die diskriminierenden Muster darin, um neue Erkenntnisse zu liefern und ein feminines Gegenmodell zur männlichen Elite zu entwerfen. Dabei beschreibt sie nicht nur Formen von „toxischer“ Männlichkeit gegenüber den Frauen, sondern auch Formen, in denen „sanfte“ Männer gut handeln und die Frau als gleichberechtigte Partnerin akzeptieren. Vielleicht erkennen wir hier einen autobiografischen Verweis auf ihre glückliche Ehe mit ihrem früh verstorbenen Gatten Etienne du Castels. Auf jeden Fall hätte die differenzierte Denkerin große Themen nie einseitig betrachtet oder sich rein von ihren Gefühlen leiten lassen, wie es ihre spätmittelalterlichen Kollegen getan haben.

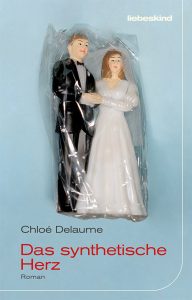
Neue Kommentare